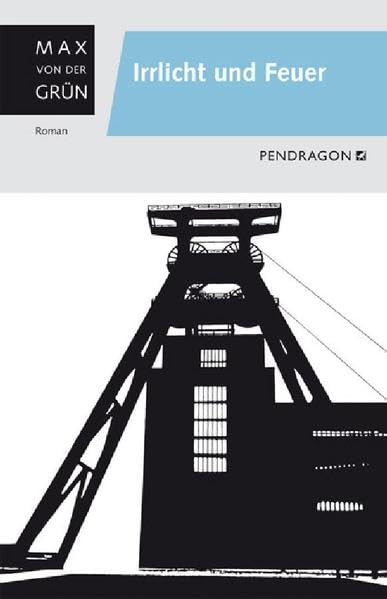Irrlicht und Feuer (Pendragon Verlag)
September 2010
Irrlicht und Feuer von Max von der Grün
In „Irrlicht und Feuer“ von Max von der Grün tauche ich tief in das düstere Leben eines Bergarbeiters im Ruhrgebiet der 1960er Jahre ein. Der Protagonist Jürgen Fohrmann ist der Inbegriff des hart arbeitenden Mannes, dessen Welt zusammenbricht, als seine Zeche geschlossen wird. Max von der Grün, selbst viele Jahre im Bergbau tätig, verarbeitet hier nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern zeichnet ein schonungsloses Bild der Entfremdung und Degradierung, die das Leben eines Arbeiters prägen.
Ein Roman von bedrückender Aktualität
Max von der Grün beschreibt mit prägnanter Sprache den Alltag der „kleinen Leute“ in einer Gesellschaft, die sich im Wirtschaftswunder nach dem Krieg immer mehr auf Effizienz und Profit konzentriert. Die zentralen Themen des Buches – soziale Ungerechtigkeit, die Vereinzelung des Individuums und die Kritik am kapitalistischen System – sind auch heute noch hochaktuell.
Jürgen Fohrmann, der Protagonist, verliert seine Identität, als er gezwungen ist, von der Zeche in die Elektrofabrik zu wechseln. Was zunächst wie ein sozialer Aufstieg wirkt, entpuppt sich schnell als Illusion. In der neuen, automatisierten Arbeitswelt fühlt er sich ebenso verraten wie zuvor von der Gewerkschaft und den Vorgesetzten in der Zeche. Max von der Grün schildert hier eindrucksvoll, wie ein ganzes System von Angst und Kontrolle aufgebaut wird, in dem der Arbeiter nicht mehr als Mensch, sondern nur noch als eine Funktion innerhalb des Betriebes existiert.
Kritischer Blick auf die Gesellschaft
Von der Grün, dessen Werk als Klassiker der Arbeiterliteratur gilt, scheut nicht davor zurück, Kritik sowohl an den Arbeitgebern als auch an den Gewerkschaften zu üben. In einem System, in dem Fehler – sei es auch nur das Verpassen eines Schichtbeginns – fatale Folgen haben können, gibt es für die Arbeiter kaum Hoffnung auf Veränderung. Dieser ständige Druck führt zu einer inneren Zerrissenheit. Der Protagonist beschreibt diese Zerrissenheit als „zwei Adame“, einen, der stur seine Arbeit verrichtet, und einen anderen, der erst außerhalb der Zeche zu leben beginnt.
In „Irrlicht und Feuer“ wird nicht nur die individuelle Not des Protagonisten thematisiert, sondern die Erfahrung einer ganzen Generation von Arbeitern, die durch den Strukturwandel und die Entindustrialisierung des Ruhrgebiets in existenzielle Krisen geraten sind.
Stil und Erzählweise
Die Ich-Perspektive verleiht dem Roman eine besondere Intensität. Man fühlt sich als Leser direkt mit dem Protagonisten verbunden und erlebt hautnah seine inneren Kämpfe und äußeren Widrigkeiten. Besonders stark ist die nüchterne, sachliche Sprache, die die Schwere der beschriebenen Situationen verstärkt. Hier spricht ein Autor, der selbst weiß, wovon er schreibt – von der Grün arbeitete selbst über 13 Jahre als Bergmann unter Tage und war somit Teil der Welt, die er so treffend beschreibt.
Seine direkte Kritik am System führte damals zu heftigen Reaktionen. Arbeitgeber klagten gegen von der Grün, weil sie sich durch die Darstellung eines Unfalls im Buch angegriffen fühlten. Diese Klage wurde jedoch letztlich zugunsten des Autors entschieden, was dem Werk zusätzliche Bekanntheit verschaffte und die Diskussion über die Rechte der Arbeiter weiter anheizte.
Informationen zum Autor
Max von der Grün (1926–2005) gehört zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern der Nachkriegszeit. Er war nicht nur Autor, sondern auch ein politisch engagierter Mensch, der sich immer wieder für die Rechte der Arbeiter stark machte. Seine eigene Biografie als Bergmann im Ruhrgebiet floss in viele seiner Werke ein, insbesondere in „Irrlicht und Feuer“, das 1963 erschien und schnell zu einem Klassiker der sogenannten „Arbeiterliteratur“ avancierte. Von der Grün galt stets als jemand, der die Dinge ohne Umschweife beim Namen nannte – eine Eigenschaft, die ihm sowohl Bewunderer als auch Gegner einbrachte.
Fazit
„Irrlicht und Feuer“ ist nicht nur ein spannender und mitreißender Roman, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte. Es ist eine Anklage gegen ein ungerechtes Wirtschaftssystem und zugleich eine eindringliche Erzählung über den Verlust der eigenen Identität in einer industrialisierten Welt. Auch heute, viele Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung, hat der Roman nichts von seiner Relevanz verloren. Die Themen, die Max von der Grün aufgreift – soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und die Entfremdung des Individuums – sind aktueller denn je. Wer sich für Literatur interessiert, die sich mit den existenziellen Fragen des Lebens auseinandersetzt, sollte diesen Klassiker unbedingt lesen.